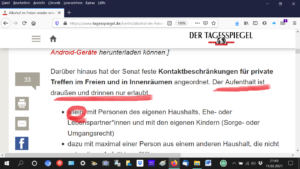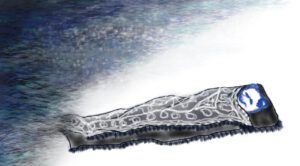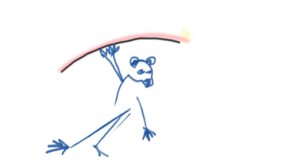Werden mich unsere Enkel- und Urenkelkinder fragen: „Du hast doch alles gewusst, warum hast Du nichts getan?“ – Nein. Solche Fragen wird niemand mehr stellen.

Haben Sie davon etwas mitbekommen? Ich nicht. Dabei ist es seit 20.10.20 in der BRD ein Gesetz: In einem Jahr, ab Januar 22, wird jedes ärztliche Rezept nur noch digital ausgestellt werden.
IBM stellt den Server, auf dem die Rezepte liegen werden. Und die Gematik entwickelt grad noch die Software für die Apple- und die Google- und die Huawei-Handys und Tablets aller PatientInnen, auf denen alle Rezepte dann landen.
Und all die – IBM, Apple, Google, Huawei zum Beispiel – freuen sich auf diesen unglaublichen Datenschatz.
Denn es ist doch geil zu wissen, wer welches Anti-Depressivum bekommt, wer Viagra und wer MS-Medikamente.
Bislang wussten das mein Arzt, meine Apotheke und meine Krankenkasse.
Dann wissen es auch Apple, Google, Huawei, IBM, alle Geheimdienste, alle Headhunter, mein Kollege, der schon immer auf meinen Posten scharf war, alle Hacker, die mich damit jederzeit erpressen können, und natürlich mein Chef.
Chef der Gematik ist übrigens jener Busenfreund von Gesundheitsminister Spahn, der zuvor Pharma-Manager war, Spahn die Wohnung in Schöneberg verkauft hat und von ihm dann zum Chef der Gematik gemacht wurde.
Haben Sie etwas davon mitbekommen?
~ ~ ~
Und haben Sie mitbekommen, dass die „elektronische Patientenakte“, die unsere Regierung genauso zwangseinführt, noch viel unerträglicher ist, weil damit der obrigkeitliche Durchgriff auf Sie als Mensch, also als körperliches und mithin an- und hinfälliges Wesen, noch viel unerträglicher ist – aus genau den gleichen Gründen wie beim E-Rezept?
Und haben Sie etwas davon mitbekommen, dass ab August diesen Jahres in der BRD nur noch Personalausweise mit Fingerabdruck ausgestellt werden (wen wundert’s da, dass man „wg. Corona“ keinen Termin im Bürgeramt bekommt, um seinen Ausweis zu verlängern)?
Ich kaue gottseidank so sehr an meinen Fingerkuppen, dass keine Biometrie da was finden wird, was vermessen werden kann.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Haben Sie von alldem irgendetwas mitbekommen?
Interessiert es Sie überhaupt?
Vermutlich nicht. Denn Sie sind ja eine unbescholtene Bürgerin, ein unbescholtener Bürger. Da darf Väterchen Staat doch gern sehen, welche Medikamente der Herr Doktor Ihnen aufgrund welcher Diagnosen verschreibt. Und Ihr Chef darf das auch sehen, denn Sie sind ja voll leistungsfähig. Und was sollten sich Hacker für Sie allenfalls mal saisonal mittelmalades Unschuldslamm interessieren; die erpressen doch nur dort, wo es sich lohnt, nicht wahr?
Träumen Sie weiter.
Falls Sie mal ein paar Stunden wach sein sollten, bitte ich Sie, ein oder zwei Bücher zu lesen (und BITTE bestellen Sie die nicht bei Amazon!):
George Orwell: 1984.
Aldous Huxley: Schöne neue Welt. (Originaltitel: „Brave New World“ – also: „Tapfere neue Welt“ trifft’s vielleicht eher).
„Dröpche für Dröpche“ (in meiner Kindheit gab es da mal so eine Werbung, da ging es – bezeichnenderweise – um Milch). Bald werde ich mich niederlegen.
Und ich weiß, dass ich niemanden verrate, genauso wenig wie ich Schuld an diesem grauenhaften Versagen der Gattung „Mensch“ trage. Jedenfalls nicht mehr Schuld als Sie.