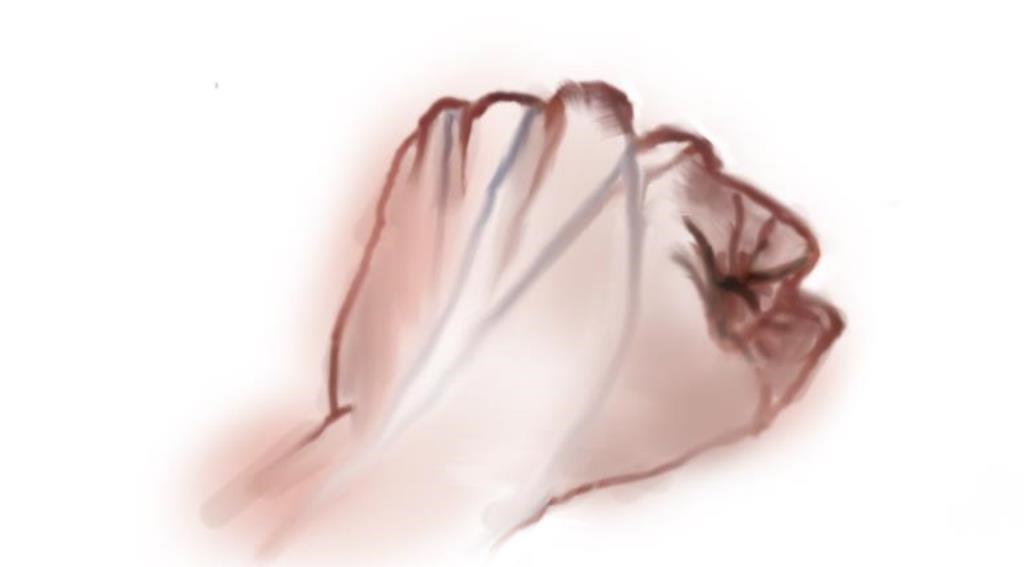Dass die Gattung „Mensch in Industrienation“ (auch Finanzindustrienationen) nun vollends verrückt geworden ist, weil sie den Tod ums Verrecken abzuwehren versucht, ist für mich mittlerweile unstrittig. Ich diskutiere da nicht mehr.
Ich sitze mir weiterhin als Krähe auf der Schulter.
Und sehe zu.
Diesem vollends entgleisten Treiben all dieser Milliarden von Menschen.
Ich sehe zu:
All diesen SchamanenCoV2.0.:
den Virologen, Epidemologen, Pulmologen, Pathologen und sonstigen „Wissenschaftlern“ (sorry, es sind ja fast alles nur Männer, drum verkneife ich mir die Nomina im Femininum) , die entweder nie begriffen oder nun vergessen haben, was „Wissenschaft“ heißt (nämlich: dass Wissen nichts sicher Verfügbares ist, keine Wissen-keit, -heit, -ung, sondern etwas, das hergestellt, das stetig geschaffen werden muss. Und beim Wissen – anders als zum Beispiel bei Mutter- oder Vaterschaft – nicht nur einmal, sondern immer wieder und wieder und wieder, und wieder neu.).
Ich sehe zu:
All diesen StammeshäuptlingenCoV2.0.:
den PolitikerInnen und sonstigen Staatsfuzis, die munter Entscheidungen auf der Grundlage des SchamanenCoV2.0.-Knochenwürfchens und -Blätterrauchens treffen und unbekümmert Menschenrechte und das Grundgesetz begraben, blindlings dem Faschistischen Charakter wieder aufhelfen, und sich ansonsten – vom eigenen Machtrausch offenbar besoffen – in Duodez-Fürstentümer-Dekreten ergehen.
Ich sehe zu:
All diesen PostillonenCoV2.0.: den JournalistInnen, die rasant und gänzlich ungebremst von Verstand oder auch nur von Vernunft im Sekundentakt in ihr klebrig-weltumspannendes Netz hinausposaunen, wie viele Menschen zum Beispiel heute in der Stadt X gestorben sind – und dabei verschweigen, wie viele Menschen täglich normalerweise in der Stadt X sterben; und dabei verschweigen, dass die heutigen Toten fast alle sehr alt und sehr lange schon sehr krank waren; und dabei verschweigen, wie viele jüngere oder gar junge Menschen heute gestorben sind, weil die leeren Krankenhäuser für die verboten sind; und dabei verschweigen, wie viele Menschen heute den Gedanken gehabt haben, sich und ihr Leben aufzugeben, weil sie nicht mehr arbeiten dürfen in dem Beruf, für den sie lange Jahre gelernt haben, und mit dem sie sich und oft noch andere Menschen ernähren; und dabei verschweigen, dass jeder Mensch irgendwann stirbt.
Ich sehe zu:
All diesen Blockwarten und BlockwärterinnenCoV2.0., die nun aus sich selbst hervorgekrochen kommen und in denen ihre Groß-, womöglich gar Urgroßeltern fröhliche Urständ feiern. Und die jederzeit mich anzeigen werden:
Ab dem 27. April herrscht im ÖPNV in Berlin die Pflicht, „Mund-Nase-Schutz“ zu tragen. Ich habe da einen lange anberaumten Zahnarzt-Termin, es geht nach Jahrzehnten erstmals wieder um etwas Großes&Teures, und die Praxis ist für’s flitzerote Fahrrad zu weit weg. Vorhin habe ich mir testhalber eins meiner ewig nicht mehr getragenen Seidentücher vor’s Gesicht gebunden: Da ist verdammt schlecht Luftholen!
Also denunzieren mich vielleicht ein paar der BlockwartendenCoV2.0. da am kommenden Montag.
Und wer weiß: Vielleicht haben wir ja demnächst auch die ersten „Nase-Mund-Schutz“-Erstickungsopfer. Womöglich häufen sich bald auch die Erstickungsanfall-Panik-Attacken.
Aber für all die ist ja kein Rettungswagen und keine Notfallstation und kein Krankenhausbett mehr frei.
Muss doch alles für „Corona“ und unsere multimoribunden 85-Jährigen vorgehalten werden, für die mittelalten Adipösen mit Herzkrankheit und Bluthochdruck, für die alterslosen RaucherInnen mit COPD, und für die wenigen jungen Menschen, die auch ohne „Corona“ immer an irgendetwas sterben [tja, stellt Eur vor: Das passiert jeden Tag! Ich kann es bezeugen], so wie wir alle irgendwann an irgendetwas sterben (da hilft alles Betten-Vorhalten nichts – und das ist gut so!).
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Ich habe es damals gespürt. Es war ein Fehler. Dass ich 2018 erstmals ein Opern-Abo für die Saison 2019/20 gekauft habe (und im Jahr darauf für die diesjährige). Es war ein Fehler. Kein Mensch mit meinen Erfahrungen sollte jemals derartig weit in die Zukunft hinein planen: mehr als ein ganzes Jahr – niemals! Eine Woche ist schon zu viel!
Ich habe damals darüber nachgedacht, spürend, dass es ein Fehler ist. Und ich habe damals den zweiten Fehler begangen, mich tatsächlich darüber zu freuen, dass ich es tat, dass ich dieses Abo kaufte, dass es mir acht Jahre nach dem Tod wieder möglich geworden war, daran zu „glauben“, dass ich in einem Jahr und drei Monaten noch leben würde.
Alles falsch. Alles lächerlich. Alles geschehen. Ich sehe es, mich, da so von meiner Schulter aus, lege den Kopf schief, krächze verhalten und fliege davon, wissend, dass ich auch den nächsten Fehler begehen werde.
Bis zum Ende.
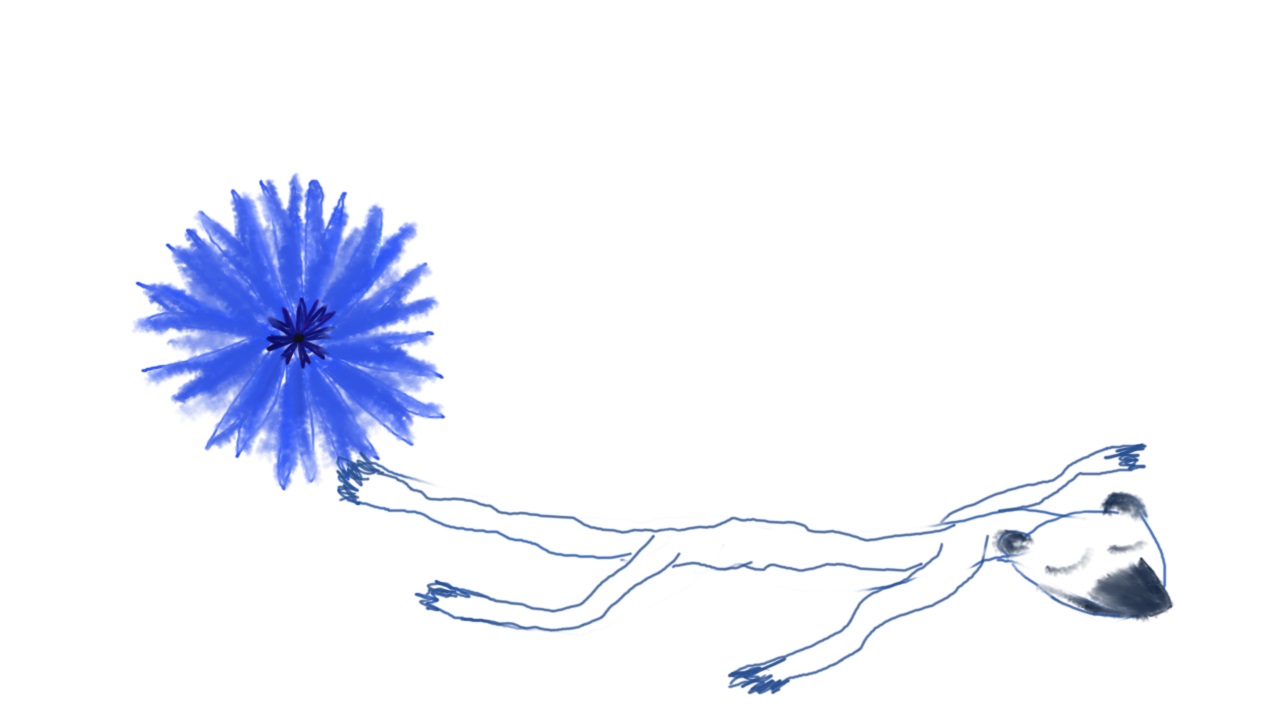
 . Das darf. Ich muss nichts mehr. }
. Das darf. Ich muss nichts mehr. }